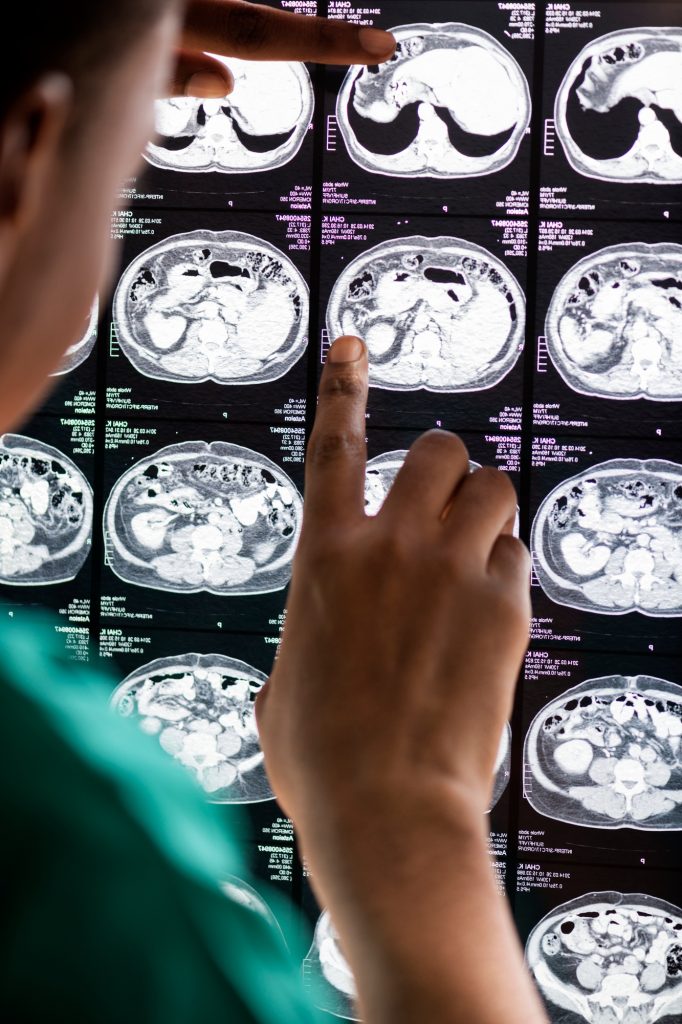Spezialisierte Behandlungen im European Medical Center
Unser neurologisches Zentrum in Cala d’Or bietet ein breites Spektrum an spezialisierten Behandlungen für neurologische Erkrankungen. Von Neurorehabilitationsprogrammen bis hin zur Tiefenhirnstimulation (DBS) bei Bewegungsstörungen – wir setzen auf innovative und effektive Lösungen, um das Wohlbefinden unserer Patienten zu verbessern.
Krankheitsbilder, die wir behandeln
Im European Medical Center ist unser Neurologie-Team auf die Behandlung von Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Kopfschmerzen und Migräne spezialisiert. Wir setzen uns dafür ein, unseren Patienten eine einfühlsame und fachkundige Versorgung zu bieten.
Im European Medical Center bieten wir stets den besten Service. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Neurophysiologie
Mit Dr. José Luís Chulilla Campanales
Unsere über zwanzigjährige Erfahrung in der klinischen Neurophysiologie in Cala d’Or hat zur Erweiterung unserer medizinischen Abteilungen beigetragen. Unser Hauptziel ist es, eine medizinische Versorgung von höchster Qualität zu bieten. Unsere Sprechstunden sind sorgfältig organisiert, um die relevantesten klinischen Fälle in der Neurophysiologie zu behandeln. Wir legen großen Wert auf exzellente Patientenbetreuung und garantieren einen erstklassigen Service.
SCHLAFEINHEIT
Schlaf ist genauso wichtig wie Essen und Trinken und spielt eine entscheidende Rolle für das allgemeine Wohlbefinden. Ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus ist unerlässlich für die langfristige mentale Gesundheit. Fast jeder dritte Erwachsene berichtet über Schlafstörungen oder Tagesmüdigkeit. Um die vielfältigen Ursachen dieser Probleme zu erkennen, ist oft eine umfassende Untersuchung im Schlaflabor erforderlich.
In unseren Einrichtungen führen wir gründliche Tagesanalysen des Schlafverhaltens durch, insbesondere nach einer Nacht mit Schlafentzug. Während der Schlafanalyse erfassen wir verschiedene biologische Signale des Körpers, um unter anderem Gehirnwellen (mittels Elektroenzephalogramm), Augenbewegungen (mittels Elektrookulogramm), Muskelspannung (mittels Elektromyogramm), Sauerstoffsättigung, Herzschlag (EKG) und Körperhaltung zu messen. Diese Auswertungen ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Schlafmuster und helfen dabei, mögliche schlafbezogene Störungen zu diagnostizieren und zu behandeln.
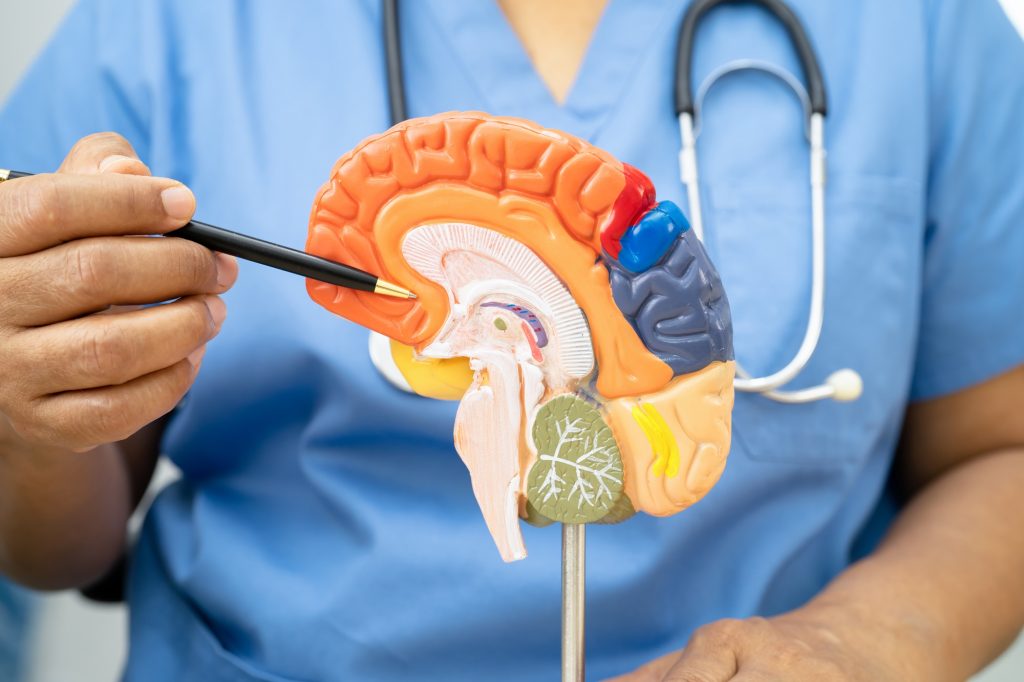
Internationale Klassifikation der Schlafstörungen (ICSD)
DYSOMNIEN
Angeborene Schlafstörungen: Vielfalt verstehen
- Psychophysiologische Insomnie: Schlafprobleme, die durch psychologische Faktoren beeinflusst werden.
- Idiopathische Insomnie: Chronische Schlaflosigkeit ohne erkennbare Ursache.
- Narkolepsie: Unkontrollierbare Tagesschläfrigkeit und plötzliche Schlafanfälle.
- Rezidivierende oder idiopathische Hypersomnie: Übermäßige Tagesschläfrigkeit ohne klare Ursache.
- Posttraumatische Hypersomnie: Verlängerter und intensiver Schlaf nach einem Trauma.
- Schlafapnoe-Syndrom: Atemaussetzer während des Schlafs, die die Erholung stören.
- Störung der periodischen Beinbewegungen: Rhythmische Beinbewegungen, die den Schlaf beeinträchtigen.
- Restless-Legs-Syndrom: Unangenehmes Gefühl in den Beinen mit Bewegungsdrang während der Ruhe.
Externe Schlafstörungen: Einflussfaktoren verstehen
- Unzureichende Schlafhygiene: Schlechte Schlafgewohnheiten, die die Schlafqualität beeinträchtigen.
- Umweltbedingte Schlafstörung: Schlafstörungen durch äußere Einflüsse.
- Höheninsomnie: Schlafstörungen, die durch große Höhen ausgelöst werden.
- Anpassungsbedingte Schlafstörung: Schwierigkeiten bei der Anpassung an neue Schlafrhythmen.
- Assoziationsstörung bei der Schlafinitiierung: Probleme, einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu etablieren.
- Lebensmittelallergie-Insomnie: Schlafstörung im Zusammenhang mit allergischen Reaktionen auf Nahrungsmittel.
- Nächtliches Ess- und Trinksyndrom: Aufnahme von Nahrung oder Getränken während des Schlafs.
- Schlafstörungen durch Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinnahme: Schlafprobleme aufgrund von Substanzkonsum.
Zirkadiane Schlafrhythmusstörungen: Die innere Uhr im Gleichgewicht halten
- Schnellwechsel-Zeitzonensyndrom (Transozeanisches Syndrom): Störungen durch schnelle Zeitzonenwechsel.
- Schlafstörung bei Nachtarbeitern: Schwierigkeiten bei Menschen, die nachts arbeiten.
- Verzögertes Schlafphasensyndrom: Einschlafen erst spät in der Nacht möglich.
- Vorverlagertes Schlafphasensyndrom: Frühes Einschlafen und Aufwachen.
- Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wach-Rhythmusstörung: Abweichung vom natürlichen 24-Stunden-Zyklus.
PARASOMNIEN
- Verwirrtes Erwachen (Konfusions-Erwachen): Zustände von Verwirrung und Orientierungslosigkeit beim Erwachen. Es kann eine Phase von mentalem Nebel auftreten, die sich mit zunehmender Wachheit auflöst.
- Schlafwandeln (Somnambulismus): Ausführen von Handlungen im Schlaf, die normalerweise im Wachzustand geschehen – vom Umhergehen bis zu komplexen Tätigkeiten.
- Nachtschreck (Pavor Nocturnus): Nächtliche Episoden intensiver Angst mit körperlichen Reaktionen wie Herzrasen und Schwitzen. Betroffene erinnern sich meist nicht an den Vorfall.
Störungen beim Übergang zwischen Schlaf und Wachzustand
- Rhythmische Bewegungsstörungen: Wiederholte, stereotype Bewegungen beim Einschlafen oder während Wachphasen zwischen Schlafzyklen.
- Nächtliche Sprachstörungen: Abweichungen im Sprechverhalten beim Übergang zwischen Schlaf und Wachzustand.
- Nächtliche Beinkrämpfe: Plötzliche, schmerzhafte Muskelkontraktionen in den Beinen während des Einschlafens oder Aufwachens.
Parasomnien, die typischerweise mit REM-Schlaf verbunden sind
- Albträume: Intensive, belastende Träume, die häufig zum Erwachen führen.
- Schlafparalyse: Vorübergehende Bewegungs- oder Sprachunfähigkeit beim Einschlafen oder Aufwachen, oft begleitet von lebhaften Halluzinationen.
- Schlafbezogene Erektionen: Unwillkürliche Erektionen während des Schlafs, die mit Schlafstörungen zusammenhängen können.
- Schmerzhafte schlafbezogene Erektionen: Erektionen im Schlaf, die mit Schmerzen oder Beschwerden verbunden sind.
- Kardiale Arrhythmien im REM-Schlaf: Unregelmäßiger Herzrhythmus während des REM-Schlafs mit möglichen kardiovaskulären Folgen.
- REM-Schlaf-Verhaltensstörung: Abnormales Verhalten wie Bewegungen oder Lautäußerungen im REM-Schlaf, oft in Verbindung mit lebhaften Träumen.
Weitere Parasomnien
- Nächtlicher Bruxismus: Unwillkürliches Zähneknirschen oder Kieferpressen im Schlaf, was zu Zahnschäden führen kann.
- Nächtliche Enuresis: Unwillkürliches Einnässen im Schlaf, vor allem bei Kindern.
- Paroxysmale nächtliche Dystonie: Anfallsartige, ungewöhnliche Bewegungen oder Verhaltensweisen während des Schlafs.

SCHLAFSTÖRUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT MEDIZINISCHEN ODER PSYCHIATRISCHEN ERKRANKUNGEN
Schlafstörungen können mit verschiedenen psychischen, neurologischen und anderen medizinischen Faktoren in Zusammenhang stehen. Diese Assoziationen umfassen:
1. Im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen:
- Depression: Schlafstörungen können gemeinsam mit Depressionen auftreten und gestörte Schlafmuster sowie das allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigen.
2. Im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen:
- Degenerative Hirnerkrankungen: Fortschreitende Erkrankungen, die die Struktur und Funktion des Gehirns betreffen und die Schlafregulation stören können.
- Morbus Parkinson: Eine neurodegenerative Erkrankung, die zu Schlafstörungen wie Insomnie und fragmentiertem Schlaf führen kann.
- Familiäre fatale Insomnie: Eine seltene genetische Erkrankung, die schwere Schlaflosigkeit und andere neurologische Symptome verursacht.
- Schlafbezogene Epilepsie: Epileptische Anfälle, die speziell im Schlaf auftreten und die Schlafkontinuität beeinträchtigen.
- Schlafbezogene Kopfschmerzen: Kopfschmerzen, die durch Schlaf ausgelöst oder verschlimmert werden und mit neurologischen Erkrankungen verbunden sein können.
3. Im Zusammenhang mit anderen medizinischen Prozessen:
- Schlafkrankheit (Afrikanische Trypanosomiasis): Eine parasitäre Infektion, die den Schlaf-Wach-Rhythmus stört und zu starker Müdigkeit führt.
- Nächtliche kardiale Ischämie: Verminderte Durchblutung des Herzens während des Schlafs, was zu kardiovaskulären Problemen führen kann.
- Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD): Atemwegserkrankungen wie COPD können die Schlafqualität beeinträchtigen und Schlafstörungen begünstigen.
- Schlafbezogenes Asthma: Asthmasymptome, die sich im Schlaf verschlechtern und die Atmung stören.
- Schlafbezogener gastroösophagealer Reflux: Refluxereignisse, die durch Magensäure verursacht werden und den Schlaf unterbrechen.
- Magengeschwürkrankheit: Geschwüre im Magen-Darm-Trakt, die im Schlaf Beschwerden verursachen können.
- Fibrositis-Syndrom (Fibromyalgie): Eine Erkrankung, die durch Muskel-Skelett-Schmerzen und Empfindlichkeit gekennzeichnet ist und den Schlaf beeinträchtigen kann.
PSG – Nächtliche Polysomnographie im Schlaflabor
Wir führen polysomnographische Untersuchungen am Tag sowie nächtliche Polysomnographien (PSG) zur diagnostischen Abklärung durch bei:
Epilepsie
- Verschiedenen Schlafstörungen, wie z. B.:
- Dysomnien: Angeborene Schlafprobleme (Insomnie und Hypersomnie), externe Schlafstörungen sowie Störungen des zirkadianen Rhythmus
- Parasomnien: Störungen beim Erwachen, Probleme beim Übergang zwischen Schlaf und Wachzustand sowie Parasomnien im Zusammenhang mit dem REM-Schlaf
- Schlafstörungen im Zusammenhang mit medizinischen oder psychischen Erkrankungen
In unserer Schlafmedizinischen Einheit führen wir diagnostische PSG-Untersuchungen zum obstruktiven Schlafapnoe-Hypopnoe-Syndrom (OSAHS) durch und prüfen Behandlungsmöglichkeiten, einschließlich eines therapeutischen CPAP-Versuchs.

ELEKTROMYOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN, EVOZIERTE POTENTIALE UND ELEKTRORETINOGRAPHIE
EMG – Elektromyographie
Die Elektromyographie (EMG) ist eine Technik der Neurophysiologie zur Untersuchung der elektrischen Aktivität von Muskeln und der sie steuernden Nerven. Die EMG registriert die elektrischen Signale, die von Muskelzellen (sogenannten Muskelfasern) während einer Muskelkontraktion erzeugt werden.
Bei der Elektromyographie werden Elektroden auf der Haut über dem interessierenden Muskel angebracht. Diese Elektroden erfassen die elektrischen Signale, die von den Muskelzellen bei ihrer Aktivierung erzeugt werden. Die aufgezeichnete Aktivität wird als Wellenmuster dargestellt und liefert Informationen über die Muskelfunktion und nervale Steuerung.
Anwendungsgebiete der EMG:
- Medizinische Diagnostik: Zur Beurteilung und Diagnose neuromuskulärer Erkrankungen wie Neuropathien, Myopathien und peripheren Nervenschäden.
- Wissenschaftliche Forschung: Zur Untersuchung der Muskelfunktion und der Muster der Nervenaktivierung, um Erkenntnisse über Biomechanik und Bewegungsphysiologie zu gewinnen.
- Rehabilitation: Zur Bewertung der Wirksamkeit von Rehabilitationsprogrammen und zur Unterstützung bei der Genesung von Muskel- oder Nervenschäden.
- Analyse der Muskelaktivität bei Bewegung: Untersuchung der Aktivierungsmuster von Muskeln bei verschiedenen körperlichen Aktivitäten.
Zusammenfassend ist die Elektromyographie ein zentrales Instrument in der Neurophysiologie zur detaillierten Analyse der elektrischen Muskel- und Nervenaktivität – essenziell für die Diagnose und Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen sowie für das Verständnis der Muskel- und Nervenfunktion.
ENG – Elektroneurographie
Die Elektroneurographie (ENG) ist eine diagnostische Methode der Neurophysiologie zur Untersuchung der elektrischen Aktivität von Nerven. Im Gegensatz zur Elektromyographie (EMG), die die Muskelaktivität untersucht, fokussiert sich die ENG gezielt auf die Weiterleitung elektrischer Signale entlang der Nervenbahnen.
Bei der Elektroneurographie werden Elektroden strategisch positioniert, um die elektrischen Impulse zu erfassen, die Nervenzellen während der Signalweiterleitung erzeugen. Diese Technik ist wichtig zur Beurteilung der Gesundheit und Funktionalität peripherer Nerven und hilft bei der Diagnose neurologischer Erkrankungen.
Anwendungsgebiete der ENG:
- Nervenleitungsstudien: Messung der Geschwindigkeit und Stärke von Nervenimpulsen – hilfreich bei der Diagnose von Nervenkompression, Neuropathien und Nervenschäden.
- Lokalisation von Nervenschäden: Die Analyse der Leitungsmuster ermöglicht eine präzise Bestimmung von Ort und Ausmaß der Schädigung.
- Intraoperative Überwachung: Während Operationen kann die ENG zur Echtzeitüberwachung der Nervenfunktion eingesetzt werden, um Schäden zu vermeiden.
- Neurophysiologische Forschung: Trägt wesentlich zum Verständnis der Nervenfunktion und den zugrundeliegenden Mechanismen neurologischer Erkrankungen bei.
Zusammenfassend ist die Elektroneurographie eine spezialisierte neurophysiologische Methode zur Untersuchung der elektrischen Nervenaktivität – mit diagnostischem Nutzen für viele neurologische Erkrankungen und hohem Wert für Klinik und Forschung.
EP – Evozierte Potenziale
Auditive Hirnstammpotenziale (AEP / PEATC): Dienen der objektiven Beurteilung des Hörvermögens und spiegeln die Reaktionen des Gehirns auf akustische Reize wider. Sie liefern Informationen über den auditiven Pfad durch den Hirnstamm. Klinisch relevant sind sie bei der Bewertung der retrokochleären Hörbahn und zur objektiven Erkennung einer Hörminderung.
Visuell evozierte Potenziale (VEP / PEV):
Bieten Einblicke in die Sehbahn und sind besonders nützlich bei der Untersuchung des Sehnervs.
- PEV-Muster (Pattern): Bewertet die Leitfähigkeit der Sehbahn vom Sehnerv zur okzipitalen Großhirnrinde. Dabei wird ein Schachbrettmuster auf einem Monitor verwendet. Besonders sensitiv bei Multipler Sklerose, aber auch nützlich bei ischämischer Optikusneuropathie oder anderen Sehnervverletzungen.
- PEV-Blitz (Flash): Wird durch Lichtblitze ausgelöst und analysiert die Persistenz, jedoch nicht direkt die Leitfähigkeit der Sehbahn.
Somatosensorisch evozierte Potenziale (SEP / PESS): Dienen zur Bewertung der somatosensorischen Leitungsbahnen entlang des hinteren Rückenmarks. Dazu wird ein gemischter Nervenstamm wie der Medianus- oder Tibialisnerv stimuliert. Besonders hilfreich zur Beurteilung der dicken sensorischen Fasern bei peripheren Nervenläsionen, die mit herkömmlicher EMG schwer zugänglich sind. Indikationen für PESS: Guillain-Barré-Syndrom, Polyneuropathien (PNP), Multi- und Mononeuropathien, Distale Axonopathien, Plexopathien des Plexus brachialis, Radikulopathien, Myelopathien durch Spondylarthrose, Fokale Thalamus- und Hirnstammläsionen, Myoklonien, Multiple Sklerose und andere demyelinisierende Erkrankungen.

ERG Elektroretinogramm
Das Elektroretinogramm (ERG) ist ein entscheidendes Instrument im Bereich der visuellen Neurophysiologie, das verwendet wird, um die elektrische Funktion der Netzhaut, der lichtempfindlichen Schicht auf der Rückseite des Auges, zu bewerten. Dieses Verfahren zeichnet die elektrischen Reaktionen auf, die von den Fotorezeptorzellen der Netzhaut als Reaktion auf visuelle Reize erzeugt werden.
Während eines ERG werden Elektroden auf der Oberfläche des Auges platziert, um die elektrische Aktivität zu messen, die von den Netzhautzellen erzeugt wird, wenn sie durch Lichtblitze stimuliert werden. Diese elektrische Aktivität wird in eine grafische Aufzeichnung übersetzt, die die elektrische Funktion der verschiedenen Schichten der Netzhaut und ihre Fähigkeit zur Reaktion auf visuelle Reize widerspiegelt.
Das ERG ist in verschiedenen Anwendungen von Bedeutung:
- Diagnose von Augenkrankheiten: Es hilft bei der Identifikation und Bewertung von Augenkrankheiten wie Retinitis pigmentosa, Makuladegeneration und anderen Erkrankungen, die die Netzhautfunktion beeinträchtigen.
- Überwachung von Behandlungen: Es wird verwendet, um den Fortschritt von Augenkrankheiten zu überwachen und die Wirksamkeit bestimmter Behandlungen zu bewerten.
- Wissenschaftliche Forschung: Es trägt zum Verständnis der elektrischen Prozesse bei, die in der Netzhaut ablaufen, und spielt eine entscheidende Rolle in der Forschung der visuellen Neurophysiologie.
Zusammenfassend liefert das ERG wertvolle Informationen über die elektrische Funktion der Netzhaut, die für die Diagnose von Augenkrankheiten und das Verständnis der visuellen Neurophysiologie von entscheidender Bedeutung sind.
EMG Aufzeichnungen Botulinumtoxin
Die Elektromyographie (EMG) ist eine wertvolle Technik in der Neurophysiologie, die eingesetzt werden kann, um die Auswirkungen von Botulinumtoxin, einem Neurotoxin, das häufig in medizinischen und kosmetischen Anwendungen verwendet wird, zu bewerten. Botulinumtoxin wirkt, indem es die Freisetzung von Acetylcholin, einem Neurotransmitter, an der neuromuskulären Verbindung hemmt, was zu einer vorübergehenden Muskellähmung führt.
EMG-Aufzeichnungen können Einblicke in die Auswirkungen von Botulinumtoxin auf die Muskelaktivität geben. Indem Elektroden auf der Haut über den behandelten Muskeln platziert werden, kann das EMG Änderungen in den elektrischen Signalen erkennen, die von den Muskelfasern während der Kontraktion erzeugt werden. Dies ermöglicht es Ärzten und Forschern, die Reduzierung der Muskelaktivität zu beobachten, die durch das Toxin induziert wird.
Anwendungen der EMG-Aufzeichnung im Zusammenhang mit Botulinumtoxin umfassen:
- Behandlungsüberwachung: EMG kann verwendet werden, um die Wirksamkeit von Botulinumtoxin-Injektionen im Laufe der Zeit zu überwachen. Durch die Beurteilung der Veränderungen in der Muskelaktivität können Gesundheitsdienstleister Behandlungspläne für Erkrankungen wie Muskelkrämpfe, Dystonie oder kosmetische Eingriffe optimieren.
- Forschung zur neuromuskulären Funktion: EMG-Aufzeichnungen tragen zur Forschung bei, die darauf abzielt, die neuromuskulären Effekte von Botulinumtoxin zu verstehen. Diese Forschung ist entscheidend für die Weiterentwicklung des Wissens in der Neurophysiologie und die Verbesserung der Sicherheit und Wirksamkeit von Botulinumtoxin-Anwendungen.
Zusammenfassend ist die Elektromyographie ein wertvolles Instrument zur Bewertung der Auswirkungen von Botulinumtoxin auf die Muskelaktivität, zur Überwachung von Behandlungen und zur Erweiterung des Verständnisses der neuromuskulären Funktion im Bereich der Neurophysiologie.
Single Fiber EMG JITTER / SFEMG
JITTER/SFEMG ist eine spezialisierte Technik in der Neurophysiologie, die verwendet wird, um prä- und postsynaptische Störungen der neuromuskulären Übertragung zu bewerten. Dazu gehören Erkrankungen wie Myasthenia Gravis und Eaton Lambert SDR. Durch die Untersuchung einzelner Muskelfasern bietet JITTER/SFEMG Einblicke in die Funktionsweise der neuromuskulären Synapsen.
Quantitative EMG-EMG-Q / MULTI-MUP und Amplitudenstudien für myopathische Diagnosen:
Zur Diagnose myopathischer Prozesse werden quantitative EMG-EMG-Q und MULTI-MUP-Techniken sowie Amplitudenstudien eingesetzt. Diese Methoden bieten einen quantitativen Ansatz zur Bewertung der Muskelaktivität und tragen zur Identifizierung und dem Verständnis von myopathischen Erkrankungen bei.
Blinkreflex (BR) zur Untersuchung des trigeminal-fazialen Weges:
Der Blinkreflex (BR) wird als elektrophysiologisches Werkzeug verwendet, um den trigeminal-fazialen Weg zu untersuchen. Dieser diagnostische Ansatz ist besonders nützlich bei der Untersuchung peripherer Gesichtsnervenschädigungen. Durch die Beurteilung der reflexartigen Blinzelreaktion trägt der BR zur umfassenden Bewertung der Gesichtsnervenfunktion bei.
Diese elektrophysiologischen Methoden spielen eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung unseres Verständnisses von neuromuskulären Störungen und helfen bei der genauen Diagnose verschiedener Erkrankungen, was zu effektiven Behandlungsstrategien beiträgt.
Sympathisch-kutane Antwort RSC
Die Sympathisch-kutane Antwort bezieht sich auf eine physiologische Reaktion, die das sympathische Nervensystem und die Haut umfasst. Diese spezialisierte Antwort ist ein Studiengegenstand in der Neurophysiologie und von besonderer Bedeutung, um die Wechselwirkungen zwischen dem sympathischen Nervensystem und den kutanen (hautbezogenen) Funktionen zu verstehen.
Diese Antwort, auch als somato-sympathischer Reflex bekannt, wird in verschiedenen diagnostischen Studien eingesetzt, insbesondere bei der Beurteilung peripherer feiner Faserneuropathien. Erkrankungen wie Diabetes und Urämie können diesen Reflex beeinflussen, was ihn zu einem wertvollen Instrument im diagnostischen Arsenal für neuropathische Erkrankungen macht, die die feinen Fasern des peripheren Nervensystems betreffen.
Im Wesentlichen dient die Sympathisch-kutane Antwort als Schlüsselfaktor bei der Untersuchung und Diagnose von Neuropathien und liefert Einblicke in die komplexe Beziehung zwischen dem sympathischen Nervensystem und den kutanen Funktionen.
R-R Intervall
Das R-R Intervall (oder RR Intervall) hat Implikationen in der Neurophysiologie, insbesondere im Hinblick auf das autonome Nervensystem, das die Herzaktivität reguliert. Das autonome Nervensystem umfasst die sympathischen und parasympathischen Zweige, die beide die Kontrolle über das Herz ausüben und die Herzfrequenz sowie andere Aspekte der Herzfunktion beeinflussen.
Das R-R Intervall spiegelt die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ventrikelkontraktionen des Herzens wider und korreliert direkt mit der Herzfrequenz. In der Praxis wird es verwendet, um die Herzfrequenzvariabilität (HRV) zu bewerten, einen Indikator für die Fähigkeit des autonomen Nervensystems, die Herzaktivität zu modulieren.
Die Herzfrequenzvariabilität wird häufig mit dem parasympathischen Nervensystem in Verbindung gebracht. Eine Zunahme der Variabilität weist auf einen größeren parasympathischen Einfluss hin und spiegelt eine verbesserte kardiovaskuläre Anpassungsfähigkeit an Umweltanforderungen wider. Im Gegensatz dazu kann eine Abnahme der Variabilität mit einer erhöhten sympathischen Aktivität in Verbindung gebracht werden und wurde mit verschiedenen medizinischen Bedingungen in Verbindung gebracht.
In der klinischen Neurophysiologie kann die Beurteilung der R-R Intervallvariabilität Teil autonomer Studien sein, die Einblicke in den Zustand des autonomen Nervensystems geben, insbesondere in Kontexten wie Dysautonomien und neurologischen Erkrankungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das R-R Intervall eng mit der Neurophysiologie verbunden ist, indem es Informationen über die autonome Regulierung der Herzfrequenz liefert, die vom Nervensystem beeinflusst wird.

VIDEOELEKTROENPHALOGRAPHIE V-EEG
Konsultation der Video-Elektroenzephalographie und Überwachung (V-EEG)
Das Elektroenzephalogramm (EEG) dient als visuelle Darstellung der aufgezeichneten elektrischen Aktivität im Gehirn über einen bestimmten Zeitraum. Eine primäre Anwendung ist die Video-EEG (V-EEG), insbesondere für die Epilepsiediagnose. Diese diagnostische Untersuchung untersucht die bioelektrische Aktivität des Gehirns, indem sie irritative Muster während kritischer und interkritischer Phasen analysiert. Sie hilft bei der Identifizierung von EEG-Foki, unterscheidet langsame und expressive Initiationen und bewertet mögliche elektroklinische Korrelationen, die entscheidend für prä-surgische Epilepsie-Bewertungen sind. Das V-EEG ist unverzichtbar für die Diagnose, Klassifizierung und Prognose von Epilepsien.
Baseline-V-EEG-Aufzeichnungen erfolgen während des Wachzustands und bei partieller Schlafentzug, was die Leistung bei erwachsenen, neonatalen und Säuglingspatienten verbessert. Diese Aufzeichnungen, einschließlich der V-EEG-Videos im Wachzustand und derjenigen, die partiellen Schlafentzug umfassen, bieten wertvolle Einblicke in mögliche Läsionen, die Verteilung und die Natur der epileptiformen Grafikelemente. Dieses umfassende Verständnis ist entscheidend für eine präzise Diagnose, Klassifizierung und Prognose epileptischer Zustände.
Langzeit-V-EEG / LTM-Überwachung
Die erweiterte Überwachung des Wachzustands und des Schlafes durch Video-EEG / LTM (Langzeitüberwachung) ist ein diagnostisches Verfahren in der klinischen Neurophysiologie. Es umfasst die gleichzeitige Aufzeichnung der Symptome des Patienten via Video und die Erfassung der Elektroenzephalographie (EEG)-Aktivität über eine variable Dauer. Diese Methode ist von unschätzbarem Wert, um klinische Episoden wie epileptische Anfälle zu dokumentieren und die V-EEG-Aufzeichnungen während des Wachzustands, kritischer Momente und interkritischer Phasen des NREM / REM-Schlafs zu analysieren.
Die Anwendungen der Video-EEG / LTM-Überwachung im Fall von Epilepsie umfassen:
- Differentialdiagnose: Unterscheidung zwischen epileptischen und nicht-epileptischen Anfällen.
- Erkennung, Charakterisierung und Quantifizierung: Identifizierung des Anfallstyps und der Epilepsie.
- Bewertung von Auslösern: Verstehen von Faktoren, die Anfälle auslösen können.
- Bestimmung des zirkadianen Musters: Analyse des Anfallmusters über den Tag hinweg und Bewertung der Auswirkungen von Medikamenten auf Änderungen des Anfallsmusters und Verhaltens.
- Dokumentation von epileptiformen Mustern: Aufzeichnung und Bewertung epileptiformer Muster während des NREM / REM-Schlafs.
- Bewertung für Epilepsiechirurgie: Prä-surgische Bewertung von Kandidaten für eine Epilepsiechirurgie.
Dieser umfassende Überwachungsansatz liefert entscheidende Einblicke in verschiedene Aspekte.